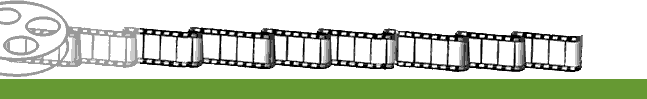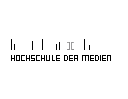Biographie
Beiträge |
Hans
Moser in zehn Thesen
Klemens Gruber (Wien)
- Heute
ist Hans Moser bei den Deutschen populär, weil er für eine
Langsamkeit steht, die sie als Lebensqualität hinterm (Wiener)
Wald schätzen. Das deutsche mittlere Management kommt gern übers
Wochenende nach Wien und nimmt sich hier hidden
refresh, während die Daheimgebliebenen „mosern“.
- Hans Mosers Hauptrequisite ist das Telephon, Inbegriff moderner
Technik der 1920er Jahre. Dazu die Koffer, seit kurzem wieder das
österreichische Schimpfwort schlechthin. Ansonsten Tratsch, läppische
Heimlichkeiten, ewige Ordnung und dienstbare Gefühlswelten, wie
sie ein romantisierendes Programm nur als Verfallsform von Romantik
bereitstellen kann.

Foto: Bettina Letz
- Das Foto zeigt Hans Moser als Schaufensterpuppe in einem Geschäft
für Jugendstilmöbel und originale Nachbauten, das sich Galerie
Ambiente nennt, in der Wiener Innenstadt. In einem solchen
Ambiente möchte das gehobene Kleinbürgertum heute leben.
Da passt der Moser als Dienstmann, als migräne-resistente Dekoration:
Fortsetzung des Jugendstils ohne das Spannungsfeld von Natur, Technik
und sublimierter Künstlichkeit.
- Mosers Gestammel ist Ausdruck der blockierten Moderne in Österreich.
Friedrich Achleitner hat die Explosion der Sprache um die Jahrhundertwende
als Resultat des Niedergangs der Habsburgermonarchie dargestellt,
nach Jahrhunderte langer Unterdrückung der sprachlichen, also
gefährlichen Künste durch die Obrigkeit bei gleichzeitiger
Favorisierung von Musik, Malerei, Architektur. Diese Entfaltung der
Sprachkunst wurde alsbald abgewürgt: vertrieben, liquidiert,
mundtot gemacht. Moser bleibt als stotternder Wittgenstein, als feixender
Kuh, als bonsaïsierter Karl Kraus.
- Dass in Liliom Hans Moser im Himmel
als dienstfertiger Pförtner arbeitet und Antonin Artaud auf der
Erde als scherenschleifender Sensenmann, charakterisiert die Lage
1934 ausreichend. (Letzterem werden die Straubs in Sicilia
ein Remake zuteil werden lassen.)
- In den 30er Jahren wird Österreich eine rückständige
Gegend. Während das deutsche Kapital die Reichsautobahn bauen
lässt, pflastert der sogenannte Ständestaat die Wiener Höhenstraße.
Hans Moser wuchert im Psychotop dieses Kopfsteinpflasters, ein Wort
übrigens, in dem die Dramatik der damaligen politischen und kulturellen
Auseinandersetzungen blitzartig abläuft.
- Zu dem, was ein Theaterlexikon Mosers „von der Filmindustrie
genützte Fähigkeit zur Darstellung kauziger Wiener Originale
für die Produktion meist belangloser Unterhaltungsfilme“
nennt, kommt eine Überdosis Provinzialismus. Ischl, Gmunden und
das steirische Salzkammergut sind die filmisch gefeierten Restl des
austro-hungarischen Imperiums: mit einem von Max Reinhardt entdeckten
begnadeten Volksschauspieler, dessen Theaterkarriere naturgemäß
hinter der Erinnerung der Fernsehöffentlichkeit verschwunden
ist. Ein rechter Kaiserschmarrn, diese Filme.
- An der Rückständigkeit ändert sich nach dem Krieg
nichts. Wien ist gar nicht mehr kosmopolitisch, das Hotel eben ein
Landgut oder besser noch eine Jagdhütte, der Portier sorgt für
Kontinuität und für alberne Züchtigkeit, während
aus den Transistorradios Rock n’ Roll nach Österreich dringt.
Und die im Fortschritt vorbeiziehenden Touristen sind allesamt Deutsche,
die sich aufführen wie gewohnt, in ihrem natürlichen Luftschutzbunker.
- Die eigentliche Gegenfigur zu Hans Moser aber ist Qualtingers Herr
Karl: Impertinenz statt Oberflächlichkeit, Opportunismus statt
Dienstfertigkeit, Perversion des Lokalen statt Lokalkolorit. Realismus
statt Sentimentalität, autochton und selbstreflexiv bis zur Aufsässigkeit.
- Hans Moser ist nicht nur Mitglied des Burgtheaters seit 1954, sondern
populäres, wenn auch unerkanntes – gewissermaßen
nichtkorrespondierendes – Mitglied der Wiener
Gruppe. Was diese in die Schreibmaschinen hämmert, bricht
aus jenem mündlich und samstagnachmittäglich als konkrete
Poesie hervor. Mit der Artikulation des Unsäglichen kommt das
Burgtheaterdeutsch eben nicht zu Rande.
- International aber wird schon die Welt von Jacques Tati konstruiert,
aus Plastik, Transparenz und zirpender Elektronik. Doch das provinzielle,
von Ost- und Westagenten bevölkerte Wien wird auch diese planetarische
Modernisierungswelle der 1960er unbeschadet überstehen. Erst
mit gehöriger Verspätung erholen sich die Wiener von einer
Epidemie der Schlafkrankheit, in der sie seit Jahrzehnten versunken.
|
Beiträge
Prof. Rolf
Coulanges
Prof.
Dr.
Mike Friedrichsen
Dr. Anton
Fuxjäger
Prof. Dr. Helmut
Graebe
Prof. Dr.
Klemens Gruber
Britta Hartmann
Prof. Dr.
Frank Kessler
Prof. Dr.
Sonja
de Leeuw
Sabine Lenk
Rolf Neddermann
Prof.
Dr. Andreas Schreitmüller
Prof. Dr. Hans J.
Wulff |