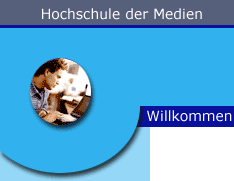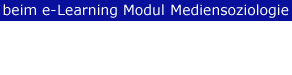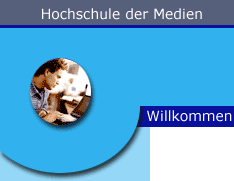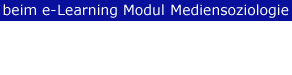| |
Ökonomische Globalisierung
Globalisierung ist in starkem Maße ein ökonomisches
Phänomen.
Grundlage für die Globalisierung in diesem Bereich ist die
Entstehung moderner Techniken der Kommunikation, des Handels und
der Finanzierung bei gleichzeitiger Liberalisierung der außenwirtschaftlichen
Beziehungen der Staaten untereinander. Im Sinne einer Weltwirtschaft
gibt es natürlich schon seit langer Zeit weit über den
Globus verteilte Teilnehmer am wirtschaftlichen Geschehen, die miteinander
interagieren, bspw. über Handelsbeziehungen.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts vollzieht sich aber ein grundlegender
Wandel in Qualität und Quantität dieser weltwirtschaftlichen
Verflechtungen. Sogenannte "global player" treten
auf die Bühne der Weltwirtschaft, Unternehmen also, die transnational
bzw. transkontinental produzieren und agieren.
Außerdem hat sich im Vergleich mit der Welt vor zwanzig Jahren
die Zahl der Teilnehmer am weltwirtschaftlichen Austausch nahezu
verdoppelt. Hinzugekommen sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion
und die ehemaligen Ostblockstaaten. Auch in Asien erwächst
starke Konkurrenz. Nicht zuletzt China mit über 1 Milliarde
Einwohnern wird in der ökonomischen Welt bald eine entscheidende
Rolle spielen. Gleichzeitig breiten sich neue Technologien und wissenschaftlicher
Fortschritt in einer global vernetzten Welt schneller aus als je
zuvor und lassen den technologischen Vorsprung der traditionellen
Industrieländer gegenüber den neuen Mitbewerbern schrumpfen.
Der Konkurrenzdruck in der globalen Wirtschaft hat sich massiv erhöht,
viele so genannte Entwicklungsländer haben ihre althergebrachte
Rolle als Rohstofflieferant und Absatzmarkt längst abgelegt.
Eine genauere historische Einordnung und Beschreibung des Phänomens
Globalisierung fällt nicht leicht, es können aber in der
wirtschaftlichen Globalisierung grob vier Phasen unterschieden werden.
Diese Phasen bauen tendenziell aufeinander auf, können aber
auch durchaus simultan ablaufende Prozesse angesehen werden.
Die erste Phase ist die Globalisierung der Gütermärkte.
Bereits seit den 50er Jahren wächst der Welthandel schneller
als die Weltproduktion. Es gehen derzeit rund drei Viertel der grenzüberschreitenden
Zahlungsvorgänge auf das Konto des klassischen Außenhandels.
Die Globalisierung der Produktion gilt als die zweite Phase
der ökonomischen Globalisierung. In den 70er Jahren kam es
unter dem Schlagwort der neuen internationalen Arbeitsteilung zunehmend
zur Verlagerung standardisierter Aktivitäten aus den Industrieländern
in ausgewählte Entwicklungsländer, dazu gehört also
bspw. der Export von Produktionsarbeitsplätzen aus den klassischen
Industriestaaten in Länder der so genannten Dritten Welt.
Darauf folgt die Phase der Globalisierung der Produktionssysteme.
In den 80er Jahren erreicht die Globalisierung eine neue Qualität
durch die zunehmende internationale Vernetzung von Produktionsprozessen
und produktionsorientierten Dienstleistungen. Neue Produktions-
und Kommunikationstechnologien ermöglichen es multinationalen
Unternehmen, sich in weltumspannenden Netzwerken von Tochterunternehmen,
Joint Ventures, strategischen Allianzen und anderen Kooperationsformen
neu zu organisieren. Das Auslandsengagement der Unternehmen zeigt
sich vor allem aber im raschen Wachstum der Direktinvestitionen.
Die letzte Phase sieht man in der Globalisierung der Finanzmärkte.
Zu Beginn der 90er Jahre entwickelt sich die Mobilität des
Finanzkapitals (Kredite, Anleihen, Aktien …) zur dynamischsten
Komponente im Globalisierungsprozess. Nicht nur Produktionsunternehmen
und Dienstleister zieht es auf internationale Märkte. Auch
Kapitalanleger und Kreditnehmer drängen jenseits der nationalen
Grenzen, um für ihr Geld möglichst hohe Renditen zu erzielen
bzw. günstige Konditionen zu bekommen. Es hat sich dabei eine
Art "virtuelle Ökonomie" (Beck) herausgebildet, in
der immer weniger mit realen Waren gehandelt wird. Der Umfang der
Finanzgeschäfte eines Tages ist inzwischen fünfzig- bis
hundertmal höher als der Umfang des gesamten Welthandels des
selben Tages. Im Zuge der Deregulierung im Bereich der weltweiten
Finanzgeschäfte hat sich eine "Globalisierung der Spekulation"
(Schmidt) in vorher nie gekanntem Maße herausgebildet, eine
Entwicklung, die durchaus kritisch gesehen werden muss.
Der Prozess der Globalisierung hat jedoch noch lange nicht die gesamte
Weltwirtschaft erfasst. Lediglich 20 Prozent der Güter und
Dienstleistungen werden international gehandelt. Zudem sind gerade
30 Prozent der Weltbevölkerung in die Weltwirtschaft integriert.
Weiterhin konzentrierte sich der Welthandel beispielsweise 1995
zu etwa 85 Prozent auf die Triade Nordamerika, Westeuropa und Asien.
Die zentralen Akteure der ökonomischen Globalisierung sind
dabei transnationale Konzerne. Diese sogenannten ‚global players'
gelten als die ,,Motoren der Globalisierung" und wickeln etwa
drei Viertel des Welthandels ab.
 |
|