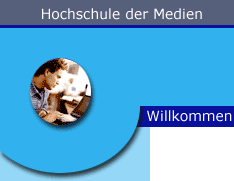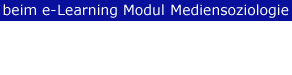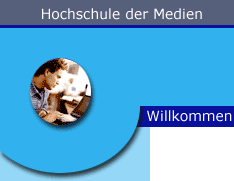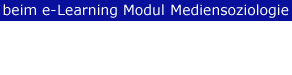| |
Globalisierung der Politik
Infolge der ökonomischen Globalisierung bricht die Wirtschaft
aus dem territorialen Rahmen aus, ohne dass entsprechende Institutionen
ihr Zügel anlegen könnten. Die nationalstaatliche Souveränität
und die Handlungsfähigkeit der Politik werden durch globale
Interaktion in Frage gestellt.
Staaten ebnen den global handelnden Unternehmen und internationalen
Finanzströmen den Weg. Sie geben damit einen Teil ihrer Handlungskompetenzen
ab und schwächen gleichzeitig ihre traditionellen wirtschafts-
und finanzpolitischen Steuerungsinstrumente wie Steuern und Zinsen.
Gerade im Bereich der Finanzmärkte und internationalen Geldströme,
haben die Nationalstaaten längst die Kontrolle über die
globalen Geschäfte verloren.
Der globale Spekulationismus mit Fokus auf kurzfristigen Gewinn
kann zerstörerische Auswirkungen haben, rücksichtslose
Spekulanten können ganze Nationalökonomien in die Krise
zu stürzen. In Japan war das vor wenigen Jahren der Fall, und
in vielen Ländern Südostasiens konnte man ähnliche
Vorgänge mitverfolgen.
Bisher existieren keine wirkungsvollen Schutzmechanismen gegen derartige
Bedrohungen, bestehende nationale Aufsichtsbehörden können
einen derartigen Schutz nicht bieten. Das transnationale, globale
Feld entzieht sich zunehmend der Kontrolle durch nationale Aufsichtsbehörden,
und somit letztlich auch der Kontrolle durch nationale Regierungen
und Parlamente.
Der Prozess der Globalisierung hat aber nicht nur unter wirtschafts-
und finanzpolitischen, sondern auch unter außenpolitischen
Aspekten vielfältige neue Abhängigkeiten und Problemlagen
zwischen den Staaten entstehen lassen.
Das Handeln einzelner Staaten oder Staatengruppen lässt nur
noch in den seltensten Fällen die Interessen anderer Staaten
unberührt. Oft ergeben sich auch bei Maßnahmen, die eigentlich
der Innen- oder Finanz- und Wirtschaftspolitik zuzurechnen sind,
direkte Auswirkungen auf Bewohner anderer Staaten. Gerade in der
Wirtschaftspolitik sind Entscheidungen inzwischen meist globale
Entscheidungen, da sie Einfluss nehmen auf die Rahmenbedingungen
für tatsächliche und potentielle Marktteilnehmer aus anderen
Ländern. Die Möglichkeiten eines Staates, seinen Interessen
im Alleingang gerecht zu werden, sind geringer geworden.
Wenn es um den Schutz globaler Güter wie bspw. im Umweltschutz
geht, sind die Staaten auf die Zusammenarbeit mit anderen angewiesen.
Die klassische Außenpolitik, die sich 350 Jahre lang als Politik
von Nationalstaaten gegenüber anderen Nationalstaaten verstanden
hat, muss ihr Selbstverständnis ändern, um der Welt des
21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Sie muss den Prozess der Globalisierung
nachholen und ihren Inhalt und ihre Instrumente radikal erweitern,
verfeinern und den neuen Gegebenheiten anpassen.
In der globalen Welt nimmt die Bedeutung von interstaatlicher Zusammenarbeit
und Staatenbündnissen deutlich zu. Kleine oder mittlere Einzelstaaten
können machtpolitisch kaum noch ins Gewicht fallen und werden
zunehmend Probleme haben, ihre Interessen adäquat vertreten.
Gerade für Europa ist es deshalb wichtig, die Zusammenarbeit
zwischen den Staaten der Union weiter zu intensivieren und als geschlossene
und durch klare politische Konturen gestärkte Einheit auf der
Bühne der Weltpolitik aufzutreten. Nur so wird es den europäischen
Staaten gelingen, ihre Interessen auf allen relevanten Gebieten
gegen die traditionellen Großmächte USA und Russland
und die zukünftige Großmacht China angemessen zu vertreten,
und sich zu behaupten im Spiel der Großmächte.
 |
|