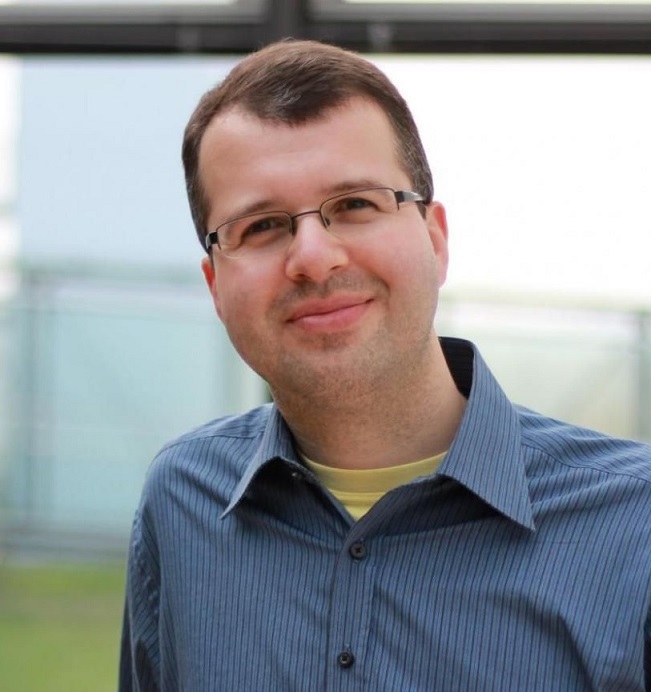Einblicke in das "Qualitätsmanagement nach der Systemakkreditierung"
Systemakkreditierte Hochschulen verfügen über eine bessere interne Kommunikation, verteilen die Verantwortung für die systematische Weiterentwicklung ihrer Studienangebote auf mehrere Schultern, pflegen einen faktenbasierten Dialog und nehmen die kritischen Empfehlungen externer Fachgutachter ernst. Auch nach der Systemakkreditierung bauen sie ihre Strukturen und Prozesse zur Qualitätssicherung und strategischen Steuerung konsequent aus.
Diese und andere Ergebnisse konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Tagung „Qualitätsmanagement nach der Systemakkreditierung“ mit nach Hause nehmen. Zu der Veranstaltung am 25. September 2014 hatten die Hochschule der Medien Stuttgart, die Hochschule Furtwangen und die Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag) eingeladen.
An die 130 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus Rektoraten, Fakultäts- und Studiengangsleitungen sowie Abteilungen für Qualitätsmanagement folgten der Einladung in die Hochschule der Medien nach Stuttgart.
Über den gelungenen Ablauf der Veranstaltung freuen sich die Projektverantwortlichen: „Wir haben ein großartiges Feedback erhalten. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns für die interessanten Fachvorträgen und die hervorragende Organisation gelobt. Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege das Wissen und Best-Practice-Sharing über Qualitätsmanagement und Systemakkreditierung voranbringen konnten."
Die Tagung wurde im Rahmen des staatlich geförderten Verbundprojekts „Qualitätsmanagement und Systemakkreditierung" ausgerichtet, an dem die Hochschule der Medien Stuttgart, die Hochschule Furtwangen und die Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag) beteiligt sind.
Welchen Nutzen systemakkreditierte Hochschulen von der Reakkreditierung haben sollen: Die Experimentierklausel des Wissenschaftsrats
Zu Beginn der Tagung hob Ministerialrat Steffen Walter, Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, die beeindruckende Zahl an systemakkreditierten Hochschulen in Baden-Württemberg hervor. Diesen Hochschulen sowie der beratenden Evaluationsagentur evalag zollte er Anerkennung.
Im Sinne des Wissenschaftsrats müsse das Ringen um beste Studienqualität auch zukünftig im Zentrum der hochschulischen Bemühungen stehen. Ministerialrat Walter verwies in diesem Zusammenhang auf die Experimentierklausel des Wissenschaftsrats, wonach auch andere Formen der externen Begutachtung unter Aufsicht und mit Genehmigung des Akkreditierungsrates möglich sein sollten. Wichtig sei allerdings, den Aufwand für die Systemakkreditierungen zu reduzieren. Seines Erachtens müssten die Reakreditierungen der Hochschulen in Zukunft weniger den Charakter von Zertifizierungen und mehr den von Empfehlungen besitzen.
Worin sich Qualitätsmanagementsysteme unterscheiden: Der Evaluations- und der Monitoringansatz
In ihrem Einführungsvortrag beschrieben Dr. Sibylle Jakubowicz von evalag und Maria Bertele, Projektmitarbeiterin im IQF-Verbundprojekt, die verschiedenen Typen von Qualitätsmanagementsystemen. Hochschulen mit Evaluationssystemelementen organisieren zentrale Review-Verfahren mit externen Gutachtern, welche die Studiengänge nacheinander durchlaufen müssen. Dagegen nutzen Hochschulen, die einen stärker ausgeprägten Monitoringansatz verfolgen, Kenngrößen und interne Bewertungsmaßstäbe für die Beurteilung ihrer Studiengänge innerhalb ihrer eigenen Regelkreise.
Als Maßstab für die Funktionsweise und Funktionsfähigkeit von Qualitätsmanagementsystemen kristallisierte Dr. Sibylle Jakubowicz drei Kriterien heraus: die Einhaltung formaler Vorgaben, etwa der Landeshochschulgesetze oder der Kultusministerkonferenz, die Einbindung externer Fachgutachter, etwa durch Peer Reviews oder in Beiräten, und die Koppelung von Qualitätssicherungsergebnissen an Steuerungsentscheidungen.
Dass Qualitätsmanagementsysteme sehr individuell ausfallen können, aber trotzdem funktionsfähig sind, konnten die Anwesenden anhand eines Vergleiches zwischen den Systemen von vier (fast) systemakkreditierten Hochschulen in Baden-Württemberg feststellen. Gegenüber gestellt wurden die Systeme der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Hochschule Furtwangen, der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und der Hochschule Aalen.
Das Erfolgsgeheimnis der Fachhochschule Münster: Kommunikation und Partizipation, effiziente Strukturen und Prozesse
Der Impulsvortrag der Präsidentin der Fachhochschule Münster, Professorin Dr. Ute von Lojewski, beleuchtete die Implikationen der Systemakkreditierung auf die Hochschulakteure, namentlich den Zusammenhang zwischen Autonomie und Selbstverantwortung.
Mehr Verantwortung in der Qualitätspolitik erfordert in erster Linie bessere Information, bessere Kommunikation und mehr Partizipation, so von Lojewski. Die Präsidentin erklärte, dass alle Hochschulakteure sich engagieren und bereit sein müssten, das System mitzutragen. Einerseits werde durch die Systemakkreditierung mehr institutionelle Verantwortung auf die Hochschulleitung und das QM-Team übertragen, was zu einer Entlastung der Fachbereiche und Studiengänge führe. Andererseits habe ihre Hochschule die Strukturen und Prozesse zur Qualitätssicherung nach der Systemakkreditierung noch weiter intensiviert und strukturiert. Zum Beispiel sei für die Durchführung der Jahresgespräche zwischen Präsidium und Fachbereichen ein Leitfaden aufgesetzt worden, die Ergebnisse und Vereinbarungen der Jahresgespräche würden in Protokollen festgehalten. Die Fachbereiche und Studiengänge sind also weiterhin in die Pflicht genommen.
Wie Kenngrößen Akzeptanz finden: Berücksichtigung der Fachkultur, gemeinsame Aushandlung
Am frühen Nachmittag behandelte das Forum 1 den Einsatz quantitativer und qualitativer Kennzahlen. Professor Dr. Anton Karle von der Hochschule Furtwangen, Professorin Dr. Cornelia Niederdrenk-Felgner von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Professor Dr. Gerhard Schneider von der Hochschule Aalen gingen der Frage auf den Grund, wieviel Messung und wieviel Diskussion Qualität benötigt und verträgt.
Professor Dr. Karle stellte den jährlichen Qulitätsbericht der Studiengänge vor, bei dem quantitative und qualitative Kenngrößen zum Studienverlaufsmonitoring mit definierten Toleranzbereichen gemäß eines Ampelsystems klassifiziert werden. Professor Schneider hob die Bedeutung von Kenngrößen als Grundlage für die objektive Diskussion, Steuerung und Kontrolle der Studiengänge im Rahmen der Planungsgespräche an der Hochschule Aalen hervor. Professorin Dr. Cornelia Niederdrenk-Felgner beschrieb das Nürtinger Modell der Qualitätsdialoge auf Basis von Qualitätsportfolios.
Alle Vortragenden waren sich darüber einig, dass es aufgrund der unterschiedlichen Fachkulturen und Fachtraditionen keine Blaupausen für Kenngrößen gebe. Für die Akzeptanz seien aber deren Herkunft, der Umgang damit und die Gestaltung der Aushandlungsprozesse zwischen Hochschulleitung und Fakultätsvertretern von eminenter Bedeutung.
Was QM-Mitarbeiter/innen erfolgreich macht: Initiative, Präsenz, Kompetenz
Das Forum 2 befasste sich mit der Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Qualitätsmanagement von Hochschulen, insbesondere im Kontext der Systemakkreditierung.
Dr. Luz-Maria Linder von der HdM Stuttgart berichtete zunächst von ihren Erfahrungen in einem eher zentral angelegten QM-System mit enger Anbindung an das Rektorat. Dabei beschrieb sie ihre Entwicklung von einer Assistentin über die Stellvertretung für das Rektorat bis hin zum Change agent mit hoher eigenverantwortlicher Gestaltungskompetenz.
Petra Suwalski von der Hochschule Furtwangen hingegen stellte ihre Funktion als Kommunikationsschnittstelle zwischen Rektorat, dem QM-Board der Hochschule, den Servicestellen sowie den Fakultäten in den Mittelpunkt ihre Vortrags. In diesem System nimmt sie sowohl beratende als auch kontrollierende Aufgaben wahr und betreut Projekte zur Organisationsentwicklung.
Den Weg ihrer Professionalisierung beschrieben beide QM-Mitarbeiterinnen als von dauerhafter Eigeninitiative und Vernetzung geprägt. Um als Expertinnen für Qualitätsmanagement innerhalb der Hochschulen anerkannt zu werden, bedarf es - neben hoher wissenschaftsorientierter Methodenkompetenz und Kommunikationsfähigkeit - der Durchsetzungsfähigkeit und Präsenz.
Welchen Nutzen externe Peer Reviews oder Beiräte haben: kritischer Diskurs auf Augenhöhe, verbindliche Impulse für die Hochschulentwicklung
Im Forum 3 diskutierten Professorin Dr. Ute von Lojewski von der Fachhochschule Münster, Professor Dr. Edgar Jäger von der Hochschule Furtwangen und Professor Dr. Mathias Hinkelmann über Chancen und Risiken der an ihren Hochschulen etablierten Verfahren zur externen Qualitätssicherung. Während die Fachhochschule Münster auf Beiräte setzt, organisieren die Hochschulen in Stuttgart und Furtwangen Peer Review-Verfahren.
Ungeachtet der Unterschiede im Detail hoben alle Vortragenden die hohe Akzeptanz der Verfahren hervor. Ziel sei es stets, „critical friends" zu gewinnen, die auf einer faktenbasierten Grundlage sowohl mit der notwendigen kritischen Distanz als auch kollegial mit dem Studiengang oder Fachbereich diskutierten und Entwicklungsimpulse und Veränderungsbedarfe herausarbeiteten. Die Hochschulleitungen seien sich durchaus bewusst, dass das Risiko von Interessenkonflikten und mangelnder Unabhängigkeit der Gutachter bestehe.
Die bisherigen Erfahrungswerte zeigten nach Einschätzung der Vortragenden, dass Empfehlungen und Auflagen durch die Externen ernst genommen würden und eine hohe Verbindlichkeit besitzen. Dafür sorge auch die Einbeziehung der Hochschulleitungen und der Gremien in das Follow-up. Eine positive Gesamtbilanz zogen die Vortragenden nicht zuletzt auch deshalb, weil externe Impulse nun verstärkt für die Strategieentwicklung der gesamten Hochschulen genutzt werden können.
Welche Effekte Qualitätsmanagement und Systemakkreditierung auf die Organisation ausüben: bessere Kommunikation, systematische Weiterentwicklung, stärkere Faktenorientierung
Am späten Nachmittag gipfelte die Fachtagung in einer Podiumsdiskussion mit Rektorats- und Fakultätsvertretern der Hochschule Stuttgart und der Hochschule Furtwangen über die Effekte der Systemakkreditierung. In einigen Punkten herrschte Konsens zwischen den Podiumsteilnehmern, in anderen traten interessante Meinungsverschiedenheiten zutage.
Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass die Einführung des Qualitätsmanagements und die Vorbereitung auf die Systemakkreditierung zu einer flächendeckenden und strukturierteren Kommunikation, einer systematischeren Weiterentwicklung und einer stärkeren Faktenorientierung an der Hochschule geführt habe. Zuweilen sei dies durchaus unter einem leichten Rechtfertigungszwang geschehen.
Während Professor Dr. Rolf Schofer, Rektor der Hochschule Furtwangen, eher eine Dezentalisierung in den Entscheidungen wahrnahm, hob Dekan Professor Dr. Udo Mildenberger von der Hochschule der Medien den institutionellen Machtzuwachs der Rektorate hervor. Allerdings stelle sich die Frage, ob dieser auch genutzt werde. Sowohl Rektor Schofer wie Professor Dr. Anton Karle, Beauftragter der Hochschule Furtwangen für die Systemakkreditierung, betrachteten das Qualitätsmanagement als etwas Stabiles, Dauerhaftes und Personenunabhängiges. Professor Dr. Roos, Rektor der Hochschule der Medien, pflichtete ihnen bei. Dieser Einschätzung hielt Dekan Mildenberger entgegen, dass sich Person und System nicht völlig voneinander trennen ließen. Für die Wirkung sei das gelebte Qualitätsmanagement wichtig, und dies verändere sich bei personellen Wechseln.
Wie gehe es nun mit dem Qualitätsmanagement nach der Systemakkreditierung weiter? Rektor Schofer aus Furtwangen wies auf die angestrebte Ausweitung des Qualitätsmanagements auf die Felder Forschung, Verwaltung und Weiterbildung hin. An der Hochschule der Medien müssten, wie Rektor Roos ins Feld führte, einige Instrumente nachgeschärft werden, zum Beispiel die Kenngrößen. Ein weiteres Ziel sei die Abstimmung mit den Systemen ausländischer Partnerhochschulen. Dekan Mildenberger brachte ein anderes Ziel ins Spiel, die stärkere Verzahnung der operativen Qualitätssicherung mit dem strategischem Management. Steuerungscharakter habe zum Beispiel auch die transparente Besprechung von Evaluationsergebnissen.
Gegen Ende der Podiumsdiskussion lobten die Rektorats- und Dekanatsvertreter einige positive Veränderungen im Hochschulklima: Der Erfolg der Systemakkreditierung habe viele kritische Stimmen in den eigenen Reihen verstummen lassen. Der Gestaltungsspielraum für Gegenkräfte habe sich verkleinert. Vor allem jüngere Professorinnen und Professoren würden mit viel Engagement bei der Sache sein.
Alles in allem also gute Voraussetzungen, um die Hochschulen in die Zukunft zu führen. Dass Systemakkreditierung diese außerordentlichen Möglichkeiten selbstbestimmten Handelns in sich birgt, hatte Rektor Roos schon am Morgen bei der Begrüßung der Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer verlautbaren lassen.
Kontakt:
Dr. Luz-Maria Linder
04. November 2014